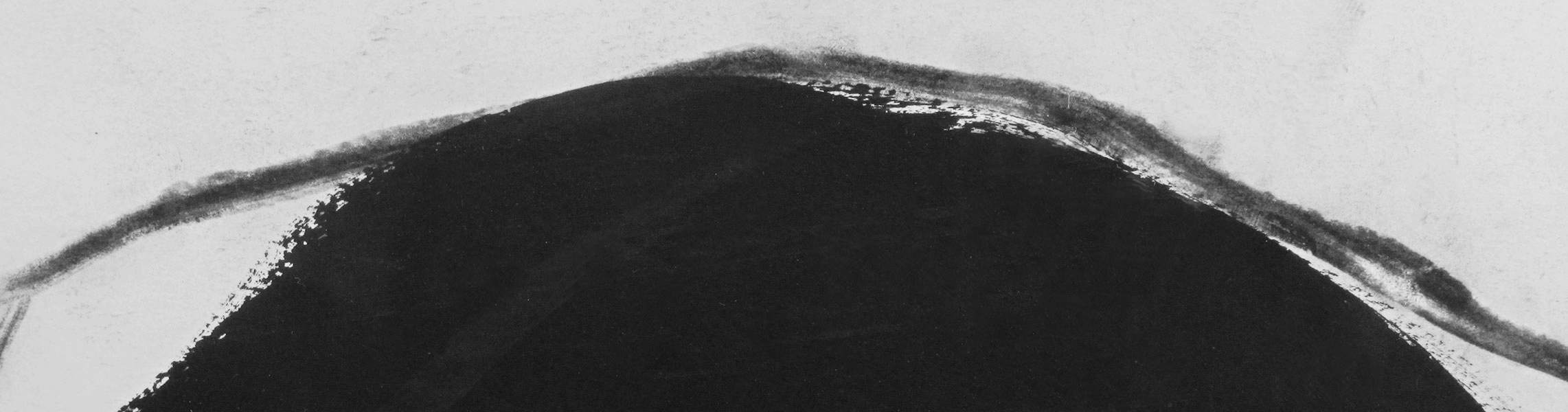Mit dem am 15. Mai 2024 in Kraft getretenen „Solarpaket 1“ soll der Ausbau der Solartechnologie in Deutschland gefördert werden. Das Gesetzespaket bringt unter anderem auch Neuerungen beim sog. Mieterstrommodell, das bei der Stromversorgung eines Mehrparteiengebäudes mit einer angeschlossenen Photovoltaik-Anlage („PV-Anlage“) zur Anwendung kommen kann. Die Ausweitung soll den Zubau von PV-Dachanlagen erhöhen und die Teilhabe an den Vorteilen der Energiewende stärken.
Der Mieterstrom ist in § 42a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sowie in § 21 Abs. 3 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geregelt. Es handelt sich um eine spezielle Form der EEG-Förderung für die dezentrale Stromversorgung von Bewohnern in Mehrparteienhäusern durch vor Ort installierte PV-Anlagen. Der Begriff „Mieterstrom“ ist nicht präzise, weil es sich bei den Bewohnern nicht um Mieter handeln muss. Das Mieterstrommodell kann auch bei Mehrparteienhäusern zum Einsatz kommen, in denen sowohl Mieter als auch Wohnungseigentümer wohnen. Außerdem muss das EEG-geförderte Modell von anderen Mieterstromkonzepten im weiteren Sinne abgegrenzt werden, die eine Versorgung mit lokal erzeugtem Strom ohne staatliche Förderung vorsehen.
EEG-geförderte Nutzungsvarianten für PV-Anlagen bei Mehrparteienhäusern
Die Betreiber von PV-Anlagen auf Mehrparteienhäusern konnten bisher zwischen zwei nach dem EEG geförderten Nutzungsoptionen wählen. Erstens konnten sie sich bei Anlagen mit einer Leistung von bis zu 100 kW dafür entscheiden, die erzeugte Energie komplett in das Netz einzuspeisen und hierfür eine erhöhte Einspeisevergütung oder – im Falle der sog. Direktvermarktung des erzeugten Stroms durch einen Dienstleister – eine erhöhte Marktprämie zu erhalten (§§ 21 Abs. 1, 48 Abs. 2 und 2a, 53 Abs. 1 EEG). Die Bewohner des Hauses beziehen in diesem Fall den Strom ausschließlich aus dem allgemeinen Versorgungsnetz. Die zweite Option für den Anlagenbetreiber besteht in der Versorgung nach dem Mieterstrommodell. Eine weitere Versorgungsmöglichkeit wurde mit dem Solarpaket 1 eingeführt: die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung nach § 42b EnWG.
Funktionsweise des Mieterstrommodells
In der Mieterstromversorgung beziehen die Hausbewohner den erzeugten Strom direkt von der PV-Anlage. Der Anlagenbetreiber ist also Stromlieferant für die Bewohner und muss damit auch alle Lieferantenpflichten nach den §§ 40 ff. EnWG erfüllen. Außerdem muss er eine Vollversorgung gewährleisten, d.h. einen Strombezug auch für solche Zeiten sicherstellen, in denen nicht genügend Mieterstrom zur Selbstversorgung erzeugt wird (§ 42a Abs. 2 Satz 6 EnWG). Im Gegenzug kann er für die Lieferung den sog. Mieterstromzuschlag nach § 19 Abs. 1 Nr. 3 EEG in Anspruch nehmen. Zudem fallen für den lokal verbrauchten Strom keine Netzentgelte, Abgaben oder Umlagen an. Der nicht lokal verbrauchte, überschüssige Strom wird in das allgemeine Versorgungsnetz gespeist, wofür der Anschlussnetzbetreiber je nach Vermarktungsmodell eine Einspeisevergütung oder Marktprämie auszahlt. Wird hingegen zu wenig Strom erzeugt, erfolgt eine zusätzliche Versorgung aus dem öffentlichen Netz, um die Versorgungslücke zu schließen.
Schutz der Mieter von Wohnräumen
Grundlage der Versorgung ist ein Mieterstromvertrag zwischen Bewohner und Anlagenbetreiber/Stromlieferant, der die Voraussetzungen des § 42a EnWG erfüllen muss. Geregelt werden vor allem Schutzvorschriften für Verbraucher bzw. Wohnraummieter. So darf etwa der Mieterstromvertrag grundsätzlich nicht an den Wohnungsmietvertrag gekoppelt sein (§ 42a Abs. 2 Satz 1 EnWG). Hiermit wird sichergestellt, dass Mieter ihren Stromlieferanten frei wählen können. Mieterstromverträge mit Verbrauchern unterliegen zudem speziellen Laufzeitbegrenzungen und Kündigungsvorschriften (§ 42a Abs. 3 EnWG). Ferner gilt bei Mietern von Wohnräumen eine Preisobergrenze von 90 % des jeweiligen Grundversorgungstarifs (§ 42a Abs. 4 Satz 1 EnWG).
Ausweitung durch das Solarpaket 1
Bisher konnte die Mieterstrom-Förderung nur dann in Anspruch genommen werden, wenn die PV-Anlage auf, an oder in einem Wohngebäude installiert war und der erzeugte Strom in diesem Gebäude oder in Wohngebäuden sowie Nebenanlagen desselben Wohnquartiers verbraucht wurde. Das Solarpaket 1 hat den Anwendungsbereich des Mieterstrommodells nach § 21 Abs. 3 EnWG deutlich ausgeweitet. Die konkrete Gebäudenutzung spielt nun keine Rolle mehr. Die Vorschriften zum Mieterstrom gelten somit auch bei PV-Anlagen auf Gewerbedächern und auf Nebenanlagen. Zudem ist es nicht mehr notwendig, dass der Strom in einem Wohngebäude verbraucht wird. Es kommen vielmehr sämtliche Gebäude und Nebenanlagen als Ort des Stromverbrauchs in Betracht, solange sie im selben Quartier liegen und den Strom von der PV-Anlage ohne Durchleitung durch ein allgemeines Versorgungsnetz beziehen. Um Missbräuchen vorzubeugen, besteht bei Gewerbegebäuden jedoch die Einschränkung, dass es sich bei Anlagenbetreibern und Strombeziehern nicht um verbundene Unternehmen handeln darf.
(19. Juli 2024)