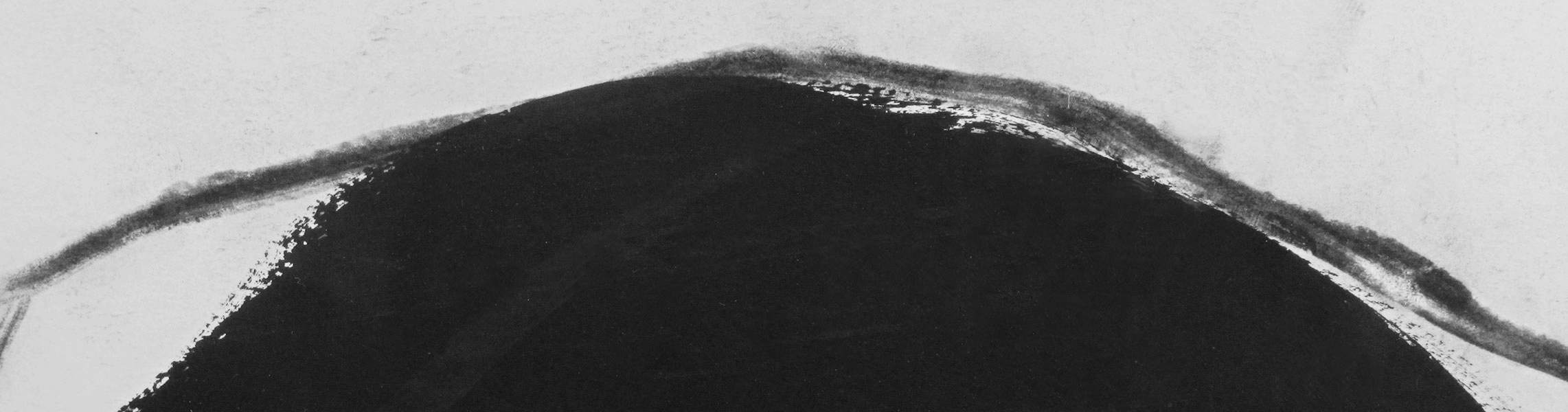In den vergangenen Jahren mehren sich zivilgerichtliche Entscheidungen, die sich mit der Zulässigkeit von Werbung mit einem nachhaltigen Produktionsprozess beschäftigen. Zwar steht eine Entscheidung des BGH hierzu noch aus. Gleichwohl lässt sich mittlerweile insbesondere aus den obergerichtlichen Entscheidungen ein handhabbarer Maßstab entnehmen, den es zu beachten gilt, wenn mit „Klimaneutralität“ oder ähnlichen Begriffen geworben werden soll. Diese Anforderungen möchten wir kurz darstellen.
Für die Frage der Zulässigkeit einer Werbung ist zunächst das maßgebliche Begriffsverständnis wesentlich. Lauterkeitsrechtlich kommt es auf das Verständnis eines durchschnittlichen Verbrauchers an. Der Begriff „Klimaneutralität“ bedeutet nach der übereinstimmenden Rechtsprechung eine „ausgeglichene Treibhausgasbilanz“. Für diesen Begriff hat sich mittlerweile die Ansicht durchgesetzt, dass einem durchschnittlichen Verbraucher bewusst ist, dass ein Unternehmen Klimaneutralität auch über Kompensationsmaßnahmen erreichen kann. Anders als die obergerichtliche Rechtsprechung hält das LG Karlsruhe Waldschutzprojekte allerdings per se für ungeeignet, um die Klimawirkungen eines Produkts vollständig auszugleichen. Der Claim der „Klimaneutralität“ gehe prinzipiell über das hinaus, was mittels CO₂-Zertifikaten aus Waldschutz erreichbar sei. Der Grund: Bäume speicherten CO2 nur vorübergehend, der vollständige Abbau dauere hunderttausende Jahre. Um die CO2-Bilanz des Produkts dauerhaft auszugleichen, müssten kontinuierlich – auch in 100 oder 1000 Jahren – weitere entsprechende Waldschutzbemühungen unternommen werden.
Trotz ihrer Ähnlichkeit zum Begriff der „Klimaneutralität“ werden Begriffe wie „CO2-Neutralität“, „Umweltneutralität“, „schadstofffrei“ oder „schadstoffarm“ von den Gerichten – zu Recht – individuell bewertet. So hat das LG Karlsruhe darauf hingewiesen, dass der Begriff „Umweltneutralität“ über den Begriff „Klimaneutralität“ hinausgehe. „Umweltneutralität“ sei nach dem durchschnittlichen Begriffsverständnis eines Verbrauchers als „Produkt mit ausgeglichener Umweltbilanz“ zu verstehen. Damit beziehe der Begriff auch Umweltauswirkungen fernab von Treibhausgasen ein. Der Begriff „CO2-Neutralität“ ist wiederum enger als „Klimaneutralität“, weil er sich nicht auf sämtliche Treibhausgase, sondern nur auf Kohlendioxid bezieht (siehe hier).
Mittlerweile besteht in der (ober-)gerichtlichen Rechtsprechung auch weitgehende Einigkeit bei der Frage, in welchem Umfang Unternehmen die Verbraucher darüber aufklären müssen, wie der beworbene nachhaltige Produktionsprozess (Klimaneutralität, CO2-Neutralität etc.) gewährleistet wird. Das OLG Frankfurt (Urteil vom 10.November 2022 – 6 U 104/22) hat entschieden, dass eine Aufklärung darüber erforderlich sei, ob die Klimaneutralität durch Einsparungen oder Kompensationsmaßnahmen erreicht werde. Zudem müsse darüber aufgeklärt werden, ob bestimmte Emissionen von der CO2-Bilanzierung ausgenommen wurden. Es müssten auch Informationen darüber bereit gestellt werden, anhand welcher Kriterien die Prüfung für etwaige Gütesiegel erfolgt sei. Es. Auch das OLG Düsseldorf (Urteil vom 6. Juli 2023 – 20 U 72/22) ist der Ansicht, dass eine Aufklärung darüber stattfinden müsse, ob die behauptete Klimaneutralität durch Einsparungen oder Kompensationsmaßnahmen erreicht werde. Das OLG Düsseldorf geht weitergehend davon aus, dass aufgrund der Kontroversen um bestimmte Ausgleichsmaßnahmen auch ein Interesse an Informationen über die Art dieser Maßnahmen bestehe.
Das LG Karlsruhe (Urteil vom 26.Juli 2023 – 13 O 46/22 KfH) stellt ebenfalls ähnliche Anforderungen an die Informationspflichten von Unternehmen bei der Verwendung des Begriffs „klimaneutral“. Es verlangt eine Aufklärung der Verbraucherinnen und Verbraucher darüber, auf welche Schritte im Lebenszyklus eines Produkts sich der Claim der Klimaneutralität bezieht, ob Klimaneutralität im Fall des konkreten Produkts durch Reduktion und/oder durch Kompensation erreicht werden soll und anhand welcher Kriterien die Prüfung für das Label des jeweiligen Zertifizierungspartners erfolgt ist. Zudem ist das LG Karlsruhe der Ansicht, dass die Aufklärungspflichten höher sind, wenn eine Produktwerbung auf ein komplexes Wirkungsgefüge, zum Beispiel ökologische Zusammenhänge zwischen Treibhausgasemissionen und deren Reduktion bzw. Kompensation, verweist. Der Begriff „Umweltneutralität“ begründe im Vergleich zu „Klimaneutralität“ noch umfangreichere Aufklärungspflichten.
Eine Besonderheit stellen etablierte Siegel dar: Bei deren Einsatz ist, entsprechend der ständigen Rechtsprechung zu Test- oder Prüfsiegeln, zusätzlich erforderlich, die Kriterien anzugeben, nach denen die Zertifizierung vorgenommen wurde. Dafür muss ein Hinweis auf eine Website erfolgen, die detaillierte Informationen zum Prüfverfahren bereitstellt. Eine kaum lesbare Prüfziffer auf der Verpackung genügt allerdings nicht.
Zur Form der Aufklärung verdichtet sich die Rechtsprechung ebenfalls zunehmend. Das OLG Frankfurt betont, es reiche aus, wenn die entsprechenden Informationen erst durch das Klicken auf einen Link einsehbar seien (sog „Medienbruch“). Das Landgericht München I (Urteil vom 8. Dezember 2023, Az. 37 O 2041/23) hat kürzlich entschieden, dass ein QR-Code auf einer Bierflasche klar und deutlich auf weitere Informationen verweisen müsse. Dieser QR-Code müsse dabei nahe genug an der umweltbezogenen Werbung platziert sein, damit der Kunde sofort erkennen könne, dass er darüber notwendige Informationen erhalte.
Es ist davon auszugehen, dass sich die bisher von der Rechtsprechung festgelegten Maßstäbe in absehbarer Zeit noch weiterentwickeln werden. Es ist bereits eine Revision beim BGH gegen das Urteil das OLG Düsseldorf vom 6. Juli 2023 anhängig. Außerdem ist auf EU-Ebene der Erlass einer Richtlinie, der sogenannten „Green Claims Directive“ geplant, welche dem Schutz von Verbraucherinnen und Verbrauchern vor Greenwashing durch Unternehmen dienen soll.
Angesichts der zunehmenden Versuche des „Greenwashings“ lässt sich eine Verstärkung der Rechtsprechung hinsichtlich der Anforderungen an umweltbezogene Werbeaussagen beobachten, vor allem bezüglich der Transparenz und der Nachweisbarkeit. Für Unternehmen ist es daher geboten, diese Anforderungen ernst zu nehmen. Bei Nichteinhaltung drohen ihnen Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche und grundsätzlich auch Schadensersatzforderungen. Anspruchsberechtigt sind Mitbewerber, Verbraucher und – in Bezug auf Unterlassungsansprüche – auch Verbraucherverbände. Schließlich drohen in manchen Fällen Geldbußen von bis zu 4 % des Jahresumsatzes.
(10. Januar 2024)